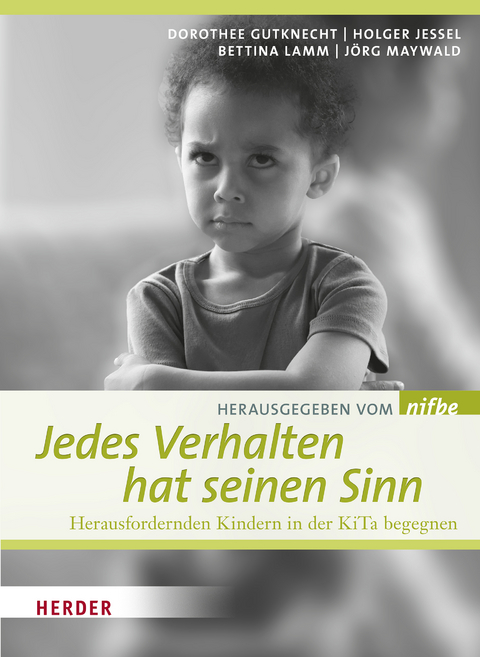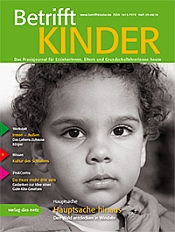Die frühen Signale
Begabung ist noch keine Leistung!
Mia kennt sich in der Raumfahrt aus. Felix liest „Emil und die Detektive“. Sind diese Kinder hochbegabt? Unser Autor ist Begabungsforscher und plädiert für eine differenzierte Betrachtung.Mia ist ein sechsjähriges Mädchen und kennt alle Schichten der Atmosphäre. Sie kann jedes Besatzungsmitglied jedem Raumschiff der USA und der Sowjetunion zuordnen, und sie kennt die Flugbahnen der ISS. Auf die Frage, wozu Freunde gut sind, hat sie jedoch keine Antwort. Felix liest Bucher, dabei ist er erst fünf Jahre alt – nicht mechanisch, sondern sinnentnehmend. Er liest die Kinderbibel und Erich Kästners „Emil und die Detektive“. Einen Stift zu halten, fällt ihm aber schwer. Er kann auch nicht schreiben.
Was halten Sie von derartigen frühkindlichen Kompetenzen? Die Beobachtungen stammen aus meiner eigenen Beratungspraxis. Ähnliche Elternberichte werden im Netz dargestellt. Man fragt sich zweifelnd: Ist so etwas möglich? Kann es das geben?
Auch wenn Sie die Kinder bedauern oder ein komisches Gefühl für deren Schulbiografie hegen: Bei all jenen Gefühlsregungen sind Sie einem hartnackigen Fehlurteil nahe. Ja, es gibt solche Kinder. Die Meinung, jemand wird erst durch Schule klug, halt sich dennoch beharrlich. Sie macht das Kindergartenkind zum Verlierer, weil es zu klein, ungeschickt, sprachlich limitiert und unlogisch sei. Erwachsene wollen im Kind nicht das Genie wahrnehmen. Beruhigungspillen wie „Das lernst du später“ oder „Das ist noch nichts für dich“ sind nur zwei Zungenschläge mitten in das Gesicht von Kindern.
Die Gedankengrenzen von Erwachsenen
Deutlich werden unsere erwachsenen Denkgrenzen immer dann, wenn Kindergartenkinder mit Kompetenzen aufwarten, die in unseren Augen bei ihnen noch nicht in dem Umfang ausgebildet sein können. Da ist die fünfjährige, früh schreibende Ulrike, deren Texte von einer ganz eigenen Weltsicht zeugen. Joris (4;12), der sich im Zahlenraum bis zu einer Million derart wohlfühlt, dass er nach Zahlenmustern und Reihen sucht. Yalda (6,0), die sich wortgewaltig in der Kita für alles stark macht, was aus ihrer Sicht ungerecht ist. Genau hier beginnen die Schwierigkeiten. Solche Kinder als begabt, hochbegabt oder zumindest als klug einzustufen, ist ebenso schwierig wie unnötig. Schwierig, weil Begabung eine DispositionDisposition|||||Wörtlich gemeint ist damit sowohl eine Anordnung von Material, als auch die physische und psychische Verfassung, Anlage, Empfänglichkeit zum Beispiel zum Lernen. für grandiose Leistungen ist, aber nicht die Leistung selbst. Das ist die Performanz, die Ausführung. Unnötig, weil eine solche Zuschreibung weder jungen Kindern noch Eltern hilft und nur pädagogischen Fachkräften eine kleine Orientierung für ihre Angebote geben konnte. Hinderlich ist zudem der mit Begriffen, Synonymen und Verengungen überfrachtete wissenschaftliche und mediale Informationsmarkt. Bringen wir daher ein wenig Licht in das Wirrwarr aus den verschiedensten Begriffen.Begabung – der Versuch einer Definition
Begabung ist die unverwechselbare Summe geistiger, motivationaler und kultureller Lern- und Leistungsvoraussetzungen. Wichtig: Sie ist die Voraussetzung – nicht die Leistung selbst! Hinzu kommen Aspekte des Selbst, also der Persönlichkeit, und deren Anspruch an sich. Die Entwicklungspsychologie sieht neben den intellektuellen auch die kreativen Potenziale, die mit der Umwelt in Kontakt treten. Bereits Kindergartenkinder besitzen demnach eine unverwechselbare Disposition von Begabungsfaktoren. Neben den Anlagen haben die beim Aufwachsen wesentlichen Umwelten und das Selbst eine große Bedeutung für Entwicklung.Noch mehr: Reifung, Prägung, Lernen, Bildung und Erziehung im Alltag haben zudem ihren Einfluss, Begabungen zu entfalten oder eben nicht wirksam werden zu lassen. Die in den 80er-Jahren entwickelte Theorie der multiplen Intelligenzen des US-amerikanischen Entwicklungspsychologen Howard Gardner geht davon aus, dass es unterschiedliche Begabungen gibt.
Die Theorie der neun Intelligenzen nach Howard Gardner
| ||
Aktuell gibt es noch keine wissenschaftlichen Belege für diese von Gardner beschriebenen Begabungsfelder. Das ist eine wesentliche Kritik an diesem Modell. Für pädagogische Fachkräfte und Eltern ist aber die differenzierte Sichtweise sinnvoll, dass es diese unterschiedlichen Intelligenzen oder Begabungsschwerpunkte gibt, da sie auf unterschiedliche Förderschwerpunkte hinweist.
Hohe Begabung – was soll das heißen?
Hochbegabung wird aktuell als geistige Disposition definiert, das heißt, als ein individuelles Fähigkeitspotenzial für ausgezeichnete Leistungen in einem oder mehreren Bereichen. Als hochbegabt wird jemand bezeichnet, dessen Intelligenzquotient (IQ) mehr als 130 betragt. Als Vergleichsgröße dienen sogenannte durchschnittlich Begabte. Alle IQ-Tests sind eigentlich keine Hochbegabungstests, weil sie auf die Durchschnittsbegabung (100 IQ-Punkte) geeicht sind. Hochbegabung bei sehr jungen Kindern verlässlich festzustellen, ist schwierig. Eltern sollten daher nur testen lassen, wenn eine diagnostische Notwendigkeit eindeutig vorliegt.Um das Potenzial zu messen – ist eine Leistung nötig. Und genau hier liegt die Crux zwischen der eigentlichen Hochbegabung als Disposition und der – nicht immer – erbrachten Leistung.
Der Begriff der Hochbegabung war Grundlage von Elitendiskussionen, in denen Hochbegabung und deren Förderung bis zum Ende der 1990er-Jahre weitgehend abgelehnt wurden. Abgelehnt unter anderem deshalb, weil geglaubt wurde, dass sich Hochbegabung ganz von selbst entfaltet. Aktuell wird nicht mehr ernsthaft davon ausgegangen, dass Hochbegabte automatisch und permanent Macht- und Herrschaftsanspruche in der Gesellschaft besetzen. Im Gegenteil: Hochbegabung ist eine unsichere Voraussagevariable für Entwicklung.
Leistung und Expertise sind nicht dasselbe
Leistung ist definiert als Tätigkeit, die in einer bestimmten Zeit Resultate hervorbringt, zum Beispiel beim Wiedergeben von Lernstoff, bei Problemlosung oder Herausarbeiten neuer Problemstellungen. Leistung kann gemessen werden. Leistung ist das Gegenstück zur Veranlagung, sie kommt zum Tragen, wenn das entsprechende Vermögen tatsächlich umgesetzt wird. In der Schule spricht man von Minderleistern, wenn eigentlich begabte Kinder ihre geistige Disposition nicht hinreichend in schulfachbezogene Leistungen ummünzen können.Expertise wird meist sowohl mit Erfahrung als auch mit der Leistung einer Person in Zusammenhang gebracht. Kinder sind nicht dummer als Erwachsene, sie haben weniger Erfahrungen, sagte der Pädagoge Janusz Korczak in seinem Buch König Hänschen I.
Maßgeblich für Expertise ist eine dauerhafte Leistungsstärke. Kindliche Gehirne sind noch plastisch, und Kinder verfügen in besonderem Maße über eine fluide Intelligenz. Ihr werden Flexibilität und die Kreativität, Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit, Intuition, das Entwickeln neuer Ideen und logisches Denken zugeschrieben.
Ein Vorteil der kindlichen fluiden Intelligenz zeigt sich in ihrem kompetenten Umgang mit digitalen Medien. Anders gesagt: Expertise ist ausschließlich für Profis reserviert. An dieser Stelle spricht man von einer kristallinen Intelligenz, die sich aus den Lernprozessen im Laufe eines Lebens ergibt. Ausnahmen bilden spezifische frühkindliche Expertisefelder wie beim eingangs erwähnten Kind Mia. Das Mädchen denkt vernetzt und verknüpft dieses Denken mit Wissen, das weit über Aufzählungen hinausgeht.
Klar sollte uns sein: Jedes Kind ist unverwechselbar. Jede individuelle Begabung ist es auch. Daher sollten wir nie gruppieren in: die Begabten, die Unbegabten oder die Durchschnittlichen.
Es gibt nur den Vergleich mit sich selbst
Wer vergleicht, hat schon verloren. Dies gilt für die Kinder ebenso wie für den Inhalt der Brieftasche oder das Auto vor der Garage. Jedes Kind hat eine unglaubliche Anzahl von Anlagen, die es unverwechselbar machen. Hinzu kommt eine große Sammlung höchst individueller Merkmale, die es von allen anderen Kindern unterscheidet. Ein unverstellter, wertschätzender Blick auf diese individuellen Besonderheiten eröffnet im besten Falle eben jene beschriebenen Zugänge.Logischerweise kann es daher nur einen Vergleich geben, den mit sich selbst. Denn nicht nur genetische Anlagen (das Mitgegebene) bestimmen uns. Bereits vor, während und vor allem nach der Geburt formt die Umwelt die junge Person. Dazu gehören natürlich die Familie und das soziale Umfeld, aber auch die Kita.
Jede Kita hat eine Menge an Materialien und Medien. Im besten Falle können sich alle Kinder entsprechend ihrer persönlichen Bedürfnisse mit etwas Interessantem beschäftigen und engagiert sein. Manches begabte Kind wird sich ungestört in kleinen oder großen Schritten durch diese Materialien arbeiten. Andere werden Anregung, Inspiration und Ermutigung brauchen.
Eltern und pädagogische Fachkräfte müssen nicht allwissend sein. Was sie professionell beherrschen sollten ist, einen Entwicklungsimpuls an genau jenes Kind und in die Gruppe hineinzubringen: ein neues Spiel, ein Quiz, einen Spaziergang oder Bücher.
Begabte Kinder, wie andere Kinder auch, nehmen sich, was sie benötigen. Bedarf es einer Anleitung, werden sich die meisten melden. Wir müssen konstatieren, dass es zwischen Kindern unglaubliche Entwicklungsunterschiede nach oben und nach unten und dazu seitwärts, in den kreativen Bereich hinein, gibt. Zuvor jedoch dürfen die pädagogischen Fachkräfte entdecken, dass es solche Kinder nicht nur in Büchern, sondern real bei ihnen in der Einrichtung gibt. Ergänzt durch die Akzeptanz, dass ein junges Kind in einem bestimmten Bereich ein umfänglicheres Wissen besitzt als sie selbst.
ZUM WEITERLESEN
- TRAUTMANN, THOMAS (2016): Einführung in die Hochbegabtenpädagogik. Hohengehren: Schneider Verlag. 3. Auflage.
- KORCZAK, JANUSZ (1995): König Hänschen I. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. 5. Auflage.
Übernahme des Beitrags mit freundlicher Genehmigung aus
TPS 3-2019, S. 4-7
TPS 3-2019, S. 4-7
- Zuletzt bearbeitet am: Freitag, 26. Juli 2019 11:34 by Karsten Herrmann