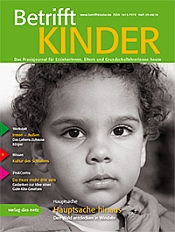DJI-Jahrestagung mit Standortbestimmung
Die veränderte Kindheit und die Perspektiven für die Entwicklung der Kindertagesbetreuung standen im Fokus der hochkarätig besetzten Jahrestagung des Deutschen Jugendinstituts. Spannende Schlaglichter wurden hier untere anderem auf die KiTa als eigener Bildungsort, die Qualitätsfrage und die Chancengerechtigkeit gerade auch im Hinblick auf Kinder aus sozial prekären Lagen oder mit Migrationshintergrund geworfen. Zum Auftakt beschrieb DJI-Direktor Prof. Dr. Thomas Rauschenbach die veränderten Koordinaten des Aufwachsens von Kindern und konstatierte eine zunehmende Verlagerung der Betreuungsaufgabe in die öffentlichen Institutionen. Während noch 1960 lediglich 15 Prozent der Kinder in der KiTa betreut wurden, stieg dieser Anteil bis 2015 auf 71 %. Das durchschnittliche Eintrittsalter lag dabei in Ostdeutschland bei 1,9 Jahren und in Westdeutschland bei 2,7 Jahren. „Die KiTa-Kindheit ist die neue Normalität“ unterstrich Rauschenbach und „heute verbringen Kinder schon mehr Zeit in der KiTa als in der Grundschule“. So würden Kindergartenkinder aktuell im Westen durchschnittlich 35 Stunden und im Osten sogar schon 42 Stunden betreut. Überraschende Daten lieferte der DJI-Direktor zu der Zeit, die Eltern aktiv mit ihren Kindern verbringen. Diese hätte nicht wie zu erwarten abgenommen, sondern sei parallel zur höheren institutionellen Betreuung sogar leicht angestiegen. Nach dem Job genössen die Kinder die zeitlich höchste Priorität – auf Kosten von Schlaf, sozialen Kontakten, Hobbys und Medienkonsum.
Zum Auftakt beschrieb DJI-Direktor Prof. Dr. Thomas Rauschenbach die veränderten Koordinaten des Aufwachsens von Kindern und konstatierte eine zunehmende Verlagerung der Betreuungsaufgabe in die öffentlichen Institutionen. Während noch 1960 lediglich 15 Prozent der Kinder in der KiTa betreut wurden, stieg dieser Anteil bis 2015 auf 71 %. Das durchschnittliche Eintrittsalter lag dabei in Ostdeutschland bei 1,9 Jahren und in Westdeutschland bei 2,7 Jahren. „Die KiTa-Kindheit ist die neue Normalität“ unterstrich Rauschenbach und „heute verbringen Kinder schon mehr Zeit in der KiTa als in der Grundschule“. So würden Kindergartenkinder aktuell im Westen durchschnittlich 35 Stunden und im Osten sogar schon 42 Stunden betreut. Überraschende Daten lieferte der DJI-Direktor zu der Zeit, die Eltern aktiv mit ihren Kindern verbringen. Diese hätte nicht wie zu erwarten abgenommen, sondern sei parallel zur höheren institutionellen Betreuung sogar leicht angestiegen. Nach dem Job genössen die Kinder die zeitlich höchste Priorität – auf Kosten von Schlaf, sozialen Kontakten, Hobbys und Medienkonsum."Neue Konturierung der frühen Kindheit"
Die „neue Konturierung der frühen Kindheit“ fasste Rauschenbach unter folgenden Stichworten zusammen:
- Institutionalisierung der frühen Kindheit
- Pädagogisierung der frühen Kindheit
- Neue Balance zwischen KiTa und Familie
- KiTa als neuer Bildungsort
 An die KiTa als (neuen) Bildungsort knüpfte auch die Leiterin der WiFF, Prof. Dr. Anke König, an und zog eine Linie von Fröbel über die Reformanstrengungen der 1970er bis zur „Post-PISA-Debatte“ und der darauf folgenden neuen Konjunktur der frühkindlichen Bildung. Allerdings sei das Versprechen einer eigenständigen frühen Bildung bisher nicht eingelöst worden. Im Vordergrund stünden eher der Verwertungsgedanke und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit habe eine „Entfremdung“ stattgefunden. Stattdessen forderte König tatsächlich das Kind und seine Subjektbildung in den Fokus zu stellen. Ziel müsse es sein, die vorhandenen Potenziale zur Entfaltung zu bringen. Dafür müsse der Bildungsort KiTa gestaltet und eine entsprechende grundlegende und nicht fachbezogene Elementardidaktik entwickelt werden. Im Bildungsort KiTa komme es auf „dialogische, relationale und situative Interaktionsprozesse“ an.
An die KiTa als (neuen) Bildungsort knüpfte auch die Leiterin der WiFF, Prof. Dr. Anke König, an und zog eine Linie von Fröbel über die Reformanstrengungen der 1970er bis zur „Post-PISA-Debatte“ und der darauf folgenden neuen Konjunktur der frühkindlichen Bildung. Allerdings sei das Versprechen einer eigenständigen frühen Bildung bisher nicht eingelöst worden. Im Vordergrund stünden eher der Verwertungsgedanke und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit habe eine „Entfremdung“ stattgefunden. Stattdessen forderte König tatsächlich das Kind und seine Subjektbildung in den Fokus zu stellen. Ziel müsse es sein, die vorhandenen Potenziale zur Entfaltung zu bringen. Dafür müsse der Bildungsort KiTa gestaltet und eine entsprechende grundlegende und nicht fachbezogene Elementardidaktik entwickelt werden. Im Bildungsort KiTa komme es auf „dialogische, relationale und situative Interaktionsprozesse“ an.Prof. Dr. Peter Cloos von der Stiftungsuniversität Hildesheim verdeutlichte im Anschluss noch einmal das Spannungsfeld, in der sich der Bildungsort KiTa befindet. Die KiTa sei „ein multifunktionales System“, das gleichzeitig von Arbeits-, Sozial- und Bildungspolitik bestimmt sei. Statt zu deklamieren und normativnormativ|||||Normativ bedeutet normgebend, somit wird etwas vorgeschrieben, dass Normen, Regeln oder ein „Sollen“ beinhaltet.e Vorgaben zu machen, müssten zunächst einmal die tatsächlichen Prozesse der Pädagogisierung im hochgradig komplexen Alltag der KiTa beobachtet und analysiert werden.
Kritische Betrachung des "Hoffnungsträgers Qualität"
 Den „Hoffnungsträger Qualität“ nahm Prof. Dr. Michael-Sebastian Honig von der Université de Luxembourg in den Fokus. Der aus dem Management stammende Begriff habe heutzutage eine Omnipräsenz und stehe für das Messen von Wirkungen, für Steuerung und Effizienz. In der frühkindlichen Bildung sei damit auch der „Outcome“, also die messbaren Entwicklungs- und Bildungsfortschritte des Kindes verbunden. Er unterstrich: „Qualität ist ein unstrittiges und erstrangiges Ziel, aber kein Wert an sich!“ Qualität sei vielmehr immer eine bewertete Gegebenheit, ein normativ-evaluatives Konzept, dass auch vom jeweiligen Bild des Kindes abhängig ist. Die entscheidende Frage sei dabei, wie solche normativen Vorgaben in der Praxis umgesetzt bzw. von der Fachkraft in der konkreten Situation hervorgebracht werden könnten. Qualität in der KiTa sei dabei nach seiner Ansicht insbesondere als „regulatives Prinzip einer reflexiven Praxis“ zu verstehen.
Den „Hoffnungsträger Qualität“ nahm Prof. Dr. Michael-Sebastian Honig von der Université de Luxembourg in den Fokus. Der aus dem Management stammende Begriff habe heutzutage eine Omnipräsenz und stehe für das Messen von Wirkungen, für Steuerung und Effizienz. In der frühkindlichen Bildung sei damit auch der „Outcome“, also die messbaren Entwicklungs- und Bildungsfortschritte des Kindes verbunden. Er unterstrich: „Qualität ist ein unstrittiges und erstrangiges Ziel, aber kein Wert an sich!“ Qualität sei vielmehr immer eine bewertete Gegebenheit, ein normativ-evaluatives Konzept, dass auch vom jeweiligen Bild des Kindes abhängig ist. Die entscheidende Frage sei dabei, wie solche normativen Vorgaben in der Praxis umgesetzt bzw. von der Fachkraft in der konkreten Situation hervorgebracht werden könnten. Qualität in der KiTa sei dabei nach seiner Ansicht insbesondere als „regulatives Prinzip einer reflexiven Praxis“ zu verstehen.Im Anschluss warf Prof. Dr. Bernhard Kalicki vom DJI noch einen Blick auf die Qualität aus Elternsicht. Die empirischempirisch|||||Empirie bezeichnet wissenschaftlich durchgeführte Untersuchungen und Erhebung, die gezielt und systematisch im Forschungsfeld oder im Labor durchgeführt werden. Empirische Forschungen können durch verschiedene Methoden praktisch angewendet werden. erhobenen elterlichen Erwartungen an Frühkindliche Bildung ergaben dabei folgende, durchaus überraschende Rangfolge:
- Entwicklung von Soziale Kompetenz
- Entwicklung von Selbständigkeit und Alltagskompetenzen
- Kulturell-musische Bildung
- Schulvorbereitung
Kalicki verdeutlichte anhand dieser Ergebnisse, dass Qualität auch durch unterschiedliche Zielvorstellungen von Eltern, Trägern, Politik oder Wissenschaft geprägt sei und man eher von „Qualitäten“ sprechen müsse. Noch kaum berücksichtigt seien dabei die Zielvorstellungen der Hauptakteure, nämlich der Kinder. Hier sei gerade bei den Kleinsten die Entwicklung neuer Methoden notwendig – wie z.B. die Messung des Stresshormons Cortisol im Speichel von Kleinkindern in Krippensituationen.
Frühkindliche Bildung mit hoher Rendite
 Schlaglichter aus einer Gesamtevaluation der wichtigsten ehe- und familienbezogenen Leistungen in Deutschland präsentierte Prof. Dr. Catharina Spieß vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Als Ziele dieser zahlreichen Leistungen von subventionierten KiTa-Plätzen über Eltern- und Kindergeld bis zum Ehegattensplitting führte sie insbesondere folgende an:
Schlaglichter aus einer Gesamtevaluation der wichtigsten ehe- und familienbezogenen Leistungen in Deutschland präsentierte Prof. Dr. Catharina Spieß vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Als Ziele dieser zahlreichen Leistungen von subventionierten KiTa-Plätzen über Eltern- und Kindergeld bis zum Ehegattensplitting führte sie insbesondere folgende an:- Wirtschaftliche Stabilität / Soziale Teilhabe der Familie
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung und Wohlergehen von Kindern
Zum letzten Ziel konnten sie anhand von Untersuchungen zur KiTa-Nutzung, dem entsprechenden Bildungs-Outcome und anhand von weiteren „Wohlergehensfaktoren“ konstatieren: „Der KiTa-Besuch hat positive Effekte auf das adaptive Verhalten und die sozio-emotionale Stabilität und dies insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund und aus Haushalten mit niedrigem Einkommens.“ Grundsätzlich bescheinigte sie der Frühkindlichen Bildung eine hohe Rendite und forderte die Politik entsprechend auf langfristig zu denken und den quantitativen und qualitativen KiTa-Ausbau nachhaltig zu verankern.
Herausforderung: Chancengerechtigkeit für alle!
Trotz einer Verdreifachung der Betreuungsquote im Westen seit 2006 musste Dr. Christian Alt vom DJI allerdings feststellen, dass gerade Kinder aus der sogenannten „Unterschicht“ nach wie vor noch später in die Krippe kommen als solche aus der Mittel- und Oberschicht. Hier gebe es unter anderem einen Zusammenhang mit der niedrigeren Erwerbsquote von Unterschichts-Müttern, aber auch unterschiedlicher Durchsetzungsfähigkeit bei der Suche nach Krippenplätzen.
 In einer abschließenden Podiumsdiskussion konstatierte DJI-Direktor Rauschenbach für die frühkindliche Bildung einen „dynamischen Modernisierungsprozess mit einigen Ungleichzeitigkeiten“. So seien die hohen Erwartungen an die Bildung, Betreuung und Erziehung in den KiTas noch nicht mit entsprechenden Ressourcen unterfüttert worden. Grundsätzlich sei die KiTa ein „eigener Bildungsort, der lebensweltorientiert und situativ ist und das spielerische Aneignen der Welt ermöglicht.“ Diese Art der Bildung gelte es noch verstärkt als „eigene konzeptionelle Leistung“ deutlich zu machen und von der Schulbildung abzugrenzen.
In einer abschließenden Podiumsdiskussion konstatierte DJI-Direktor Rauschenbach für die frühkindliche Bildung einen „dynamischen Modernisierungsprozess mit einigen Ungleichzeitigkeiten“. So seien die hohen Erwartungen an die Bildung, Betreuung und Erziehung in den KiTas noch nicht mit entsprechenden Ressourcen unterfüttert worden. Grundsätzlich sei die KiTa ein „eigener Bildungsort, der lebensweltorientiert und situativ ist und das spielerische Aneignen der Welt ermöglicht.“ Diese Art der Bildung gelte es noch verstärkt als „eigene konzeptionelle Leistung“ deutlich zu machen und von der Schulbildung abzugrenzen.Prof. em. Dr Hans Bertram von der Humboldt-Universität wies darauf hin, dass „Eltern die ausschlaggebenden und primären Bindungspersonen sind und bleiben“. Die KiTa eröffne ein neues Feld der Möglichkeiten und nun komme es auf ein enges Zusammenspiel und eine Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Institutionen an.
Eine zentrale Frage der von Jeanette Otto (DIE ZEIT) moderierten Podiumsdiskussion war die nach der Chancengerechtigkeit und der Möglichkeit, alle Kinder mitzunehmen und zu integrieren. Prof. Dr. Stefan Sell von der Hochschule Koblenz forderte dabei „ein Vielfaches an Ressourcen für KiTas in sozialen Brennpunkten.“ Notwendig seien auch spezifische Strategien, um Eltern und Kinder aus Haushalten mit Migrationshintergrund oder geringem Einkommen zu erreichen und einzubinden. Gerade auch in Anbetracht der in den KiTas erwarteten Kinder mit Fluchterfahrungen machte sich Podium für Familienzentren als „integrales Angebot“ stark.
Text: Karsten Herrmann
Fotos: DJI / David Ausserhofer
Fotos: DJI / David Ausserhofer