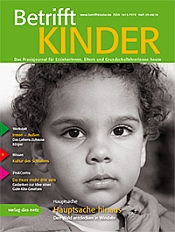Die ForscherInnen aus Deutschland, Großbritannien, Niederlande und USA stellten dabei Ansätze und Ergebnisse aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln vor – von der Evolution (Werner Grewe) und Neurophysiologie (C. Sue Carter, Steve Porges) bis hin zu (inter-) kulturellen (Heidi Keller) , makro-soziologischen (Rainer K. Silbereisen) oder soziodemographischsoziodemographisch|||||Soziodemographische Daten werden häufig in Sozialforschungen erhoben. Der Begriff, der Bevölkerungsmerkmale beschreibt, umfasst häufig Kategorien wie: Geschlecht, Alter, Familienstand, Religion, Schulabschluss, Nationalität, Haushaltsgröße etc.en (Vera Schölmerich) Aspekten.
 Prof. Dr. Dieter Wolke von der University of WarwickEine besondere Rolle spielten im Symposium auch früh- und frühstkindliche Erfahrungsfelder. So thematisierte Dieter Wolke von der University of Warwick in Coventry die Auswirkungen von Frühgeburten auf die kindliche Entwicklung und Michael E. Lamb von der University of Cambridge stellte die Ergebnisse einer Studie zum Übergang von der KiTa zur Grundschule vor. Susanne Viernickel von der Alice Salomon Hochschule in Berlin zeigte schließlich die Bedeutung von Peers in den KiTas auf.
Prof. Dr. Dieter Wolke von der University of WarwickEine besondere Rolle spielten im Symposium auch früh- und frühstkindliche Erfahrungsfelder. So thematisierte Dieter Wolke von der University of Warwick in Coventry die Auswirkungen von Frühgeburten auf die kindliche Entwicklung und Michael E. Lamb von der University of Cambridge stellte die Ergebnisse einer Studie zum Übergang von der KiTa zur Grundschule vor. Susanne Viernickel von der Alice Salomon Hochschule in Berlin zeigte schließlich die Bedeutung von Peers in den KiTas auf.An diesem Punkt sah nifbe-Forschungsstellenleiterin Prof. Dr. Heidi Keller auch dringenden weiteren Forschungsbedarf: „Bisher standen die einzelnen ErzieherInnen-Kind-Interaktionen sehr im Fokus, doch jetzt müssen wir verstärkt die Interaktionen von Kindern untereinander und die Gesamtgruppe mit ihren verschiedenen Dynamiken in den Blick nehmen.“ Der sehr intensive und konstruktive Austausch auf dem Symposium habe desweiteren gezeigt, dass noch viel mehr in verschiedenen kulturellen und soziodemographischen Umwelten von Kindern und ihren Eltern sowie zu den neurophysiologischen Grundlagen von Bildungsprozessen geforscht werden müsse – so z.B. zu den ganz individuellen Unterschieden in der Stressverarbeitung von Kindern, wie sie sich in der Herzrate ausdrückt oder auch über hormonellen Steuerungen wie dem oft fälschlicherweise als Glückshormon bezeichnete Oxytocin.
 Blick ins Publikum
Blick ins Publikum