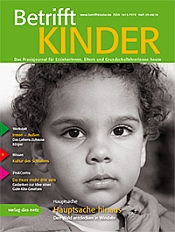Deutsche Liga feiert vierzigjähriges Jubiläum
Mit einer interdisziplinärinterdisziplinär|||||Unter Interdisziplinarität versteht man das Zusammenwirken von verschiedenen Fachdisziplinen. Dies kann auch als „fächerübergreifende Arbeitsweise“ verstanden werden, z.B wenn Psychologen, KinderärztInnen, ErzieherInnen und Lehrende zusammen an einer Fragestellung arbeiten. ausgerichteten Jahrestagung feierte die Deutsche Liga für das Kind im Berliner Abgeordnetenhaus jetzt ihr 40jähriges Bestehen. Neben den Rechten der Kinder standen dabei auch die kindliche Entwicklung aus neurobiologischer Sicht und eine Ethik der pädagogischen Beziehungen in heterogenen Gruppen im Fokus.
 Zum Auftakt zog die Präsidentin der Liga, Prof. Dr. Sabine Walper, eine erste Zwischenbilanz des Erreichten und der anstehenden Herausforderungen. Grundsätzlich sei die Liga den Rechten der Kinder in allen Lebenslagen und insbesondere in den ersten Lebensjahren verpflichtet. Auf Basis des Kinderrechtsansatzes würden Kinder dabei als eigenständige Subjekte und als Träger eigener Rechte angesehen. Dabei gelte das Prinzip der Universalität und der Unteilbarkeit. In diesem Sinne seien alle Kinder gleich und keines dürfe diskriminiert werden. Als zentrale zukünftige Arbeitsschwerpunkte führte sie drei Themen an:
Zum Auftakt zog die Präsidentin der Liga, Prof. Dr. Sabine Walper, eine erste Zwischenbilanz des Erreichten und der anstehenden Herausforderungen. Grundsätzlich sei die Liga den Rechten der Kinder in allen Lebenslagen und insbesondere in den ersten Lebensjahren verpflichtet. Auf Basis des Kinderrechtsansatzes würden Kinder dabei als eigenständige Subjekte und als Träger eigener Rechte angesehen. Dabei gelte das Prinzip der Universalität und der Unteilbarkeit. In diesem Sinne seien alle Kinder gleich und keines dürfe diskriminiert werden. Als zentrale zukünftige Arbeitsschwerpunkte führte sie drei Themen an:- Chancengleichheit und –gerechtigkeit
- KiTa-Qualitätsgesetz
- Kinderrechte in das Grundgesetz
Kinderarmut ist "eine Schande"
 In einem Grußwort unterstrich auch Bundesfamilienministerin Katarina Barley die Notwendigkeit eines Qualitätsentwicklungsgesetzes und die „Einigung zwischen Bund und Ländern auf gemeinsame Standards“. Als zentrale Herausforderung hob sie das Problem der Kinderarmut heraus, von der aktuell 19 Prozent aller Kinder betroffen oder gefährdet seien. „Das ist eine Schande“ sagte sie und verwies auf die damit verbundenen eingeschränkten Teilhabe- und damit auch Bildungschancen dieser Kinder. Ebenso wie die Deutsche Liga für das Kind sprach sich auch Katarina Barley für die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz aus, womit die Belange der Kinder z.B. bei der Verkehrsplanung oder auch im Hinblick auf den zur Zeit ausgesetzten Familiennachzug von geflüchteten Kindern und Jugendlichen besser berücksichtigt werden müssten. Grundsätzlich würdigte sie die 1989 verabschiedete UN-Kinderrechtskonvention sowie das 2000 verabschiedete Bundesgesetz zur Gewaltfreien Erziehung als „Meilensteine“, die „eine grundlegende Änderung der Einstellung gegenüber Kindern“ zur Folge gehabt hätten.
In einem Grußwort unterstrich auch Bundesfamilienministerin Katarina Barley die Notwendigkeit eines Qualitätsentwicklungsgesetzes und die „Einigung zwischen Bund und Ländern auf gemeinsame Standards“. Als zentrale Herausforderung hob sie das Problem der Kinderarmut heraus, von der aktuell 19 Prozent aller Kinder betroffen oder gefährdet seien. „Das ist eine Schande“ sagte sie und verwies auf die damit verbundenen eingeschränkten Teilhabe- und damit auch Bildungschancen dieser Kinder. Ebenso wie die Deutsche Liga für das Kind sprach sich auch Katarina Barley für die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz aus, womit die Belange der Kinder z.B. bei der Verkehrsplanung oder auch im Hinblick auf den zur Zeit ausgesetzten Familiennachzug von geflüchteten Kindern und Jugendlichen besser berücksichtigt werden müssten. Grundsätzlich würdigte sie die 1989 verabschiedete UN-Kinderrechtskonvention sowie das 2000 verabschiedete Bundesgesetz zur Gewaltfreien Erziehung als „Meilensteine“, die „eine grundlegende Änderung der Einstellung gegenüber Kindern“ zur Folge gehabt hätten.Entwicklung der Kinderrechte
Die Entwicklung der Kinderrechte nahm in der Folge auch Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit in den Blick, die sich als Juristin, Richterin und Senatorin sowie als Urgestein der Deutschen Liga dafür ein Leben lang eingesetzt hat. Zur Gründungszeit der Deutschen Liga hätten die Eltern noch die „ganze Gewalt“ über ihre Kinder gehabt und diese auch noch entsprechend häufig körperlich gezüchtigt. Erst 1980 seien Kinder als Träger eigener Rechte im Gesetz verankert und die „elterliche Gewalt“ in „elterliche Sorge“ umgemünzt worden. Auch sie wertete das absolute Gewaltverbot gegen Kinder von 2000 als großen Meilenstein im Kampf um die Kinderrechte. Als zentrales aktuelles Ziel der Deutschen Liga hob auch sie die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz heraus, „da der Staat so insgesamt mehr in die Pflicht für die Gestaltung der Lebensbedingungen von Kindern und ihren Familien genommen wird.“ Ein weiteres Ziel sei insbesondere auch angesichts der demographischen Entwicklung, mit der die Belange von Kindern herunterzufallen drohten, die Realisierung eines „Wahlrechts für Kinder von Geburt an“. Hierzu stellte in einem weiteren Vortrag der Jurist Dr. Axel Adrian entgegen der landläufigen juristischen Auffassung und mit verblüffender Argumentationskraft dar, warum das Wahlrecht für Kinder ohne große Hürden umgesetzt werden könnte bzw. sogar müsste.Zunehmende soziale Spreizung und Bedeutung der Bildung
Den engen Zusammenhang von Bildung bzw. Nicht-Bildung und einer „zunehmenden sozialen Spreizung“ führte Prof. Dr. Jutta Allmendiger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, dem Tagungspublikum eindringlich vor Augen. Dafür nahm sie fünf zentrale „Dimensionen der Ungleichheit“ in den Blick:- Lebenserwartung / Gesundheit
- Einkommen und Vermögen
- Familie / Soziales Umfeld
- Kompetenzen zur Gestaltung eines guten Lebens
- Teilhabe / Partizipation
 Wie Jutta Allmendiger ausführte, hängen die großen Unterschiede in den einzelnen Dimensionen jeweils stark mit dem Grad der Bildung zusammen. Gut Gebildete leben so wesentlich länger, haben deutlich größere Einkommen und Vermögen, einen vielfältigeren Freundeskreis und die politische Teilhabe bei Wahlen hängt extrem vom Bildungsgrad ab. Zudem gebe es die verstärkte Tendenz, dass gut ausgebildete und gut verdienende Menschen sich zunehmend untereinander verpartnerschaftlichen und so die gesellschaftliche Segregation befördern. In Bezug auf die Kompetenzen zur Gestaltung eines guten Lebens korrelierten der Glaube an die Selbstwirksamkeit und Veränderungsmöglichkeit ebenfalls mit höherer Bildung und auf der anderen Seite stehe eine tendenzielle „Angststarre“.
Wie Jutta Allmendiger ausführte, hängen die großen Unterschiede in den einzelnen Dimensionen jeweils stark mit dem Grad der Bildung zusammen. Gut Gebildete leben so wesentlich länger, haben deutlich größere Einkommen und Vermögen, einen vielfältigeren Freundeskreis und die politische Teilhabe bei Wahlen hängt extrem vom Bildungsgrad ab. Zudem gebe es die verstärkte Tendenz, dass gut ausgebildete und gut verdienende Menschen sich zunehmend untereinander verpartnerschaftlichen und so die gesellschaftliche Segregation befördern. In Bezug auf die Kompetenzen zur Gestaltung eines guten Lebens korrelierten der Glaube an die Selbstwirksamkeit und Veränderungsmöglichkeit ebenfalls mit höherer Bildung und auf der anderen Seite stehe eine tendenzielle „Angststarre“.Aus diesen Erkenntnissen heraus sei eine „präventive und auf die frühe Lebensphase ausgerichtete Bildungspolitik“ mit entsprechenden vergleichbaren und verbindlichen Qualitätsstandards notwendig. Neben einer individuellen Förderung der Kinder forderte Allmendinger auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Eltern ein: „Wir müssen Eltern abholen und aktiv gewinnen“.
Für eine präventive Bildungspolitik im Elementarbereich sei desweiteren „mehr und besser bezahltes Personal“ notwendig. Insgesamt brauche das frühe Bildungssystem „mehr Geld“ und hier sah Allmendinger auch die Wirtschaft in der Pflicht. Im Hinblick auf die Diskussion um G9 oder G8 verwies sie auf die negativen Effekte des „schnell schnell“ der vergangenen Jahre. Die Schulzeit müsse verlängert werden, denn Schule sei heute mehr denn je gefordert „soziale Kompetenzen zu vermitteln und Demokratie zu lehren.“
Frühe Weichenstellung aus neurobiologischer Sicht
 Inwieweit stellt die frühe Kindheit denn nun tatsächlich die Weichen für die zukünftige Bildungs- und Berufsbiographie? Diese Frage beantwortete Dr. Nicole Strüber anhand der Entwicklung des Gehirns in den ersten Lebensjahren. Sie nahm dabei insbesondere die Funktionen und Entwicklungen des Stress- und des Bindungssystems sowie das entsprechende „Stresshormon“ Cortisol und das „Bindungshormon“ Oxytocin in den Blick. Während zu viel Cortisol dauerhaften Stress verursachen und Nervenzellen schädigen könne, fördere Oxytocin unter anderem Vertrauen und Empathie, hemme das Stresssystem, fördere die soziale Motivation und die Wahrnehmung sozialer Reize.
Inwieweit stellt die frühe Kindheit denn nun tatsächlich die Weichen für die zukünftige Bildungs- und Berufsbiographie? Diese Frage beantwortete Dr. Nicole Strüber anhand der Entwicklung des Gehirns in den ersten Lebensjahren. Sie nahm dabei insbesondere die Funktionen und Entwicklungen des Stress- und des Bindungssystems sowie das entsprechende „Stresshormon“ Cortisol und das „Bindungshormon“ Oxytocin in den Blick. Während zu viel Cortisol dauerhaften Stress verursachen und Nervenzellen schädigen könne, fördere Oxytocin unter anderem Vertrauen und Empathie, hemme das Stresssystem, fördere die soziale Motivation und die Wahrnehmung sozialer Reize.Eine sichere verlässliche Bindung sei nun mit der Ausschüttung von Oxytocin verbunden und fördere die Entwicklung eines gut austarierten Stresssystems, einer guten Emotionsregulation und die Entwicklung verschiedener (sozialer) Kompetenzen und Ressourcen – nicht zuletzt auch spätere elterliche Kompetenzen. Eine unsichere Bindung sei hingegen mit der Ausschüttung von Cortisol und entsprechender schlechterer Stress- und Emotionsbewältigung sowie auch verminderter Leistungsfähigkeit verbunden. „Die frühe Hirnchemie prägt die spätere“ resümierte Nicole Strüwer und unterstrich damit die Bedeutung der ersten Monate und Jahre.
Für die tatsächliche Ausprägung der kindlichen Persönlichkeit seien aber neben den frühkindlichen Erfahrungen noch drei weitere Faktoren ausschlaggebend: die Gene, die vorgeburtlichen Erfahrungen und die erst in jüngster Zeit näher erforschten epigenetischen Prägungen. Bei der genetischen Ausstattung gebe es zum Beispiel gravierende Unterschiede darin, wie stark sich frühkindliche Umwelt- und damit zum Beispiel auch Bindungserfahrungen auf die Persönlichkeit auswirkten. Ebenso variiere schon aufgrund der Genausstattung die Produktion und Ausschüttung von Cortisol und Oxytocin ebenso wie deren Rezeption. Unbestritten sei aber heute, dass früher Stress zu epigenetischen Markierungen und damit zur Stilllegung bestimmter Gene führen kann. Dies habe sich sogar als vererbbar herausgestellt, so dass die Stress- oder Traumaerfahrungen der Vorfahren sich (negativ) auf die Stressreaktion der Nachfahren auswirken könnten.
Grundsätzlich, so Nicole Strüwer, könnten keine generellen Aussagen zu den Folgen unsicherer Bindungserfahrungen gemacht werden, da die jeweilige genetische Grundausstattung sehr verschieden seien und jedes Kind anders darauf reagiere. Die negativen Auswirkungen durch frühe Hirnverschaltungen und epigenetischen Markierungen seien auch nicht auf Ewigkeit festgelegt, sondern könnten durch spätere Interventionen korrigiert werden. Diese seien allerdings sehr aufwändig.
Für eine "Ethik der pädagogischen Beziehungen"
„Welches verbindliche pädagogische Ethos ist angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Pluralität“ nötig und möglich? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Vortrags von Prof. Dr. Annedore Prengel. Als grundlegende Gemeinsamkeit aller Menschen und insbesondere der Kinder hob sie den „Wunsch nach Anerkennung“ heraus. Dafür brauche es „verlässlicher, zugewandter und wertschätzender Beziehungen“. Nach einer großen Untersuchung von 12.000 Vignetten aus dem KiTa-Alltag musste die Forscherin jedoch feststellen, dass 25 Prozent aller pädagogischen Interaktionen verletzend sind. Bei einzelnen KiTas steige diese Quote auf bis zu 60 Prozent. „Seelische Gewalt ist die bei Kindern am häufigsten vorkommende Gewalt“ resümierte sie. Um solche verletzenden Interaktionen bewusst zu machen und zukünftig zu verhindern brauche es neuer Ansätze der Teamarbeit in KiTas wie z.B. der Supervision und des Coachings. Ziel sei eine professionelle Haltung, die den Kindern einerseits verlässlichen Halt und andererseits den Raum für die eigenen Schritte biete.
Nach einer großen Untersuchung von 12.000 Vignetten aus dem KiTa-Alltag musste die Forscherin jedoch feststellen, dass 25 Prozent aller pädagogischen Interaktionen verletzend sind. Bei einzelnen KiTas steige diese Quote auf bis zu 60 Prozent. „Seelische Gewalt ist die bei Kindern am häufigsten vorkommende Gewalt“ resümierte sie. Um solche verletzenden Interaktionen bewusst zu machen und zukünftig zu verhindern brauche es neuer Ansätze der Teamarbeit in KiTas wie z.B. der Supervision und des Coachings. Ziel sei eine professionelle Haltung, die den Kindern einerseits verlässlichen Halt und andererseits den Raum für die eigenen Schritte biete.„Es ist dringend notwendig verbindliche ethische Prinzipien einer solchen professionellen Pädagogik zu formulieren“ unterstrich Prengel. Ziel sei die „Anerkennung aller Menschen“ auf der Grundlage der universellen Menschenrechte. Einen ersten Ansatz böten hier die in Kooperation verschiedener ExpertInnen und Institutionen erarbeiteten „Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen“. Kernelemente seien hier:
- Kinder wertschätzend ansprechen und behandeln; Kinder nicht diskriminierend, respektlos, demütigend oder übergriffig behandeln
- Anleitung zur Selbstachtung der Kinder und Anerkennung der anderen
Zukunft der Kinderrechte
 Zum Abschluss der Jubiläumstagung der Deutschen Liga für das Kind standen noch einmal die Kinderrechte im Fokus. Prof. Dr. Lothar Krappmann, unter anderem ehemaliges Mitglied des UN-Ausschusses für die Rechte der Kinder, sah für die Zukunft eine „Doppelaufgabe“: Einerseits müssten die bestehenden Kinderrechte konsequent verwirklicht, verstärkt und erweitert sowie das Verständnis für sie vertieft werden. „Zum anderen müssen wir Kinder selber verstärkt an ihrer Umsetzung beteiligen und sie zu Mitverantwortlichen machen“. So gehöre die Menschenrechtsbildung ins Kerncurriculum von Schulen und es müsse eine „Infrastruktur für die Beteiligung und auch Beschwerde von Kindern“ geschaffen werden. Dazu gehöre auch das Wahlrecht für Kinder. Global gesehen sah Lothar Krappmann die Kinderrechte auf vielfältige Weise bedroht: Durch Krieg, Vertreibung, Umweltkatastrophen, durch Armut, Ausbeutung, Gewalt und fehlende Bildung. Europa kritisierte er dafür, „dass es erst Flüchtlinge erzeugt und dann die Rechte von geflohenen Kindern beschneidet“ – zum Beispiel durch die Aussetzung des Familiennachzugs.
Zum Abschluss der Jubiläumstagung der Deutschen Liga für das Kind standen noch einmal die Kinderrechte im Fokus. Prof. Dr. Lothar Krappmann, unter anderem ehemaliges Mitglied des UN-Ausschusses für die Rechte der Kinder, sah für die Zukunft eine „Doppelaufgabe“: Einerseits müssten die bestehenden Kinderrechte konsequent verwirklicht, verstärkt und erweitert sowie das Verständnis für sie vertieft werden. „Zum anderen müssen wir Kinder selber verstärkt an ihrer Umsetzung beteiligen und sie zu Mitverantwortlichen machen“. So gehöre die Menschenrechtsbildung ins Kerncurriculum von Schulen und es müsse eine „Infrastruktur für die Beteiligung und auch Beschwerde von Kindern“ geschaffen werden. Dazu gehöre auch das Wahlrecht für Kinder. Global gesehen sah Lothar Krappmann die Kinderrechte auf vielfältige Weise bedroht: Durch Krieg, Vertreibung, Umweltkatastrophen, durch Armut, Ausbeutung, Gewalt und fehlende Bildung. Europa kritisierte er dafür, „dass es erst Flüchtlinge erzeugt und dann die Rechte von geflohenen Kindern beschneidet“ – zum Beispiel durch die Aussetzung des Familiennachzugs.
Dass die Kinderrechte noch weit davon entfernt sind, frühzeitig und fest in den Köpfen der Menschen verankert zu sein, zeigte auch eine abschließende und von Liga-Geschäftsführer Prof. Dr. Jörg Maywald moderierte Podiumsdiskussion. An ihr nahmen auch drei Studierende des Masterstudiengangs Childhood Studies and Children’s Right an der Universität Potsdam teil, die unisono berichteten, von der UN-Kinderrechtskonvention erst in ihrem Studium erfahren zu haben. In diesem Sinne bleibt noch viel zu tun bei der Bekanntmachung und Realisierung der Kinderrechte. Als zentralen Hebel unterstrich in der weiteren Diskussion Dr. Thomas Fischbach stellvertrend für viele andere Diskutanten und ReferentInnen der Tagung einmal mehr die „Bildungsförderung und die Bildungsteilhabe“.
Text: Karsten Herrmann
Fotos: Michael Winkler
Fotos: Michael Winkler