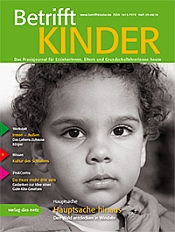Emm(i)y Bergmann (1887-1972)
Doris von Hatzfeld konstatiert treffend: "Während Clara Grunwald in der gegenwärtigen Literatur zur Geschichte der Montessori-PädagogikMontessori-Pädagogik|||||Montessoripädagogik wurde von Maria Montessori ab 1907 als pädagogisches Bildungskonzept vom Kleinkind bis zum jungen Heranwachsenden entwickelt. Leitspruch der Pädagogik ist "Hilf mir es selbst zu tun" und arbeitet mit offenem Unterricht und freien Verfügungsphasen, in dem der Lehrende dazu angehalten ist die Lernprozesse angemessen anzuregen. große Beachtung findet, ist demgegenüber ihre um zehn Jahre jüngere Schwester Emmy Bergmann noch völlig vergessen. Dabei hatte sie durchaus beachtenswerte Leistungen erbracht, die seinerzeit die Montessori-Pädagogik in Deutschland voranbrachten und innovativ bereicherten" (Hatzfeld 2000, S. 5).Leben und Wirken
 Emmy Bergmann (Quelle: Ida Seele-Archiv)Emmi Miriam Grunwald erblickte am 15. September 1887 in Berlin das Licht der Welt. Nach dem Besuch der Volksschule und der höheren Mädchenschule absolvierte sie die 1893 von Helene Lange in Berlin gegründeten "Gymnasialkurse für Frauen", "einen prestigebesetzten Schultyp, der erstmals auf ein - allerdings extern an einem Knabengymnasium abzulegendes - Abitur vorbereitete" (Kleinau/Opitz 1996, S. 132). Anschließend studierte sie Medizin in ihrer Heimatstadt und in München. Nach dem Staatsexamen, das Emmy Grunwald 1912 erfolgreich ablegte, heiratete sie den (später international bekannten) Chemiker Max Bergmann (1886-1944). Aus der Ehe, die Mitte der 1920er Jahre geschieden wurde, gingen zwei Kinder hervor: Peter Gabriel (der ein weltberühmter Physiker wurde) und Esther Marie. Noch im gleichen Jahr ihrer Heirat promovierte Emmy Bergmann mit einer Arbeit "Über Psoriasis und Gelenkerkrankung". Im Jahre 1914 übernahm sie eine unbezahlte Assistentenstelle für Kinderheilkunde am Berliner "Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus". Es folgten Anstellungen in der Säuglingsfürsorge und schließlich als Schulärztin. Anfang September 1922 übersiedelte die Familie Bergmann nach Freiburg/Brsg. Die praktizierende Kinderärztin widmete sich immer mehr pädagogisch-psychologischen Fragen. Sie absolvierte ein Lehrerinnenseminar und legte zu Beginn des Jahres 1925 das Lehrerinnen-Examen ab. Zwischenzeitlich hatte sie noch in Amsterdam einen "Internationalen Montessori-Kurs" besucht und die Lehrbefähigung für die Montessori-Methode erworben. Ihr montessorianisch / pädagogisch-psychologisches Wissen erweiterte sie noch zusätzlich durch Bildungsreisen nach England, Italien und in die Schweiz. Maria Montessori und ihre Schwester Clara Grunwald unterstützten sie in ihrem Ansinnen, in Freiburg/Brsg. Montessori-Einrichtungen zu gründen. Im Frühjahr 1925 eröffnete Emmy Bergmann in ihrer Wohnung das erste Montessori-Kinderhaus in Baden. Zwei Jahre später gründete sie einen Zweigverein der von Clara Grunwald ins Leben gerufenen "Deutschen Montessori-Gesellschaft", der von ihr auch geleitet wurde. Hinzu kam noch eine Montessori-Volksschule mit gelegentlicher Ganztagsbetreuung. In ihrer Privatschule gab es "keine Zeugnisse, keine Versetzungen im üblichen Sinne. Hier wird der Arbeitswille, die Arbeitsfreudigkeit des Kindes anerkannt, jede Arbeit, die dem Bemühen, das Beste zu geben, geleistet wird. Die Arbeit wird nicht abgeurteilt nach ihrem äußeren Erfolge, vor allem nicht nach dem Verhältnis, in dem sie zur Arbeit der anderen steht. Aber das Kind erlangt die wertvolle Erkenntnis, daß jede Arbeit ihren Lohn und ihren Wert in sich selbst trägt, und daß die innere Befriedigung über die Arbeit das höchste Glück ist, daß der Mensch erringen kann" (Bergmann 1925, S. 168).
Emmy Bergmann (Quelle: Ida Seele-Archiv)Emmi Miriam Grunwald erblickte am 15. September 1887 in Berlin das Licht der Welt. Nach dem Besuch der Volksschule und der höheren Mädchenschule absolvierte sie die 1893 von Helene Lange in Berlin gegründeten "Gymnasialkurse für Frauen", "einen prestigebesetzten Schultyp, der erstmals auf ein - allerdings extern an einem Knabengymnasium abzulegendes - Abitur vorbereitete" (Kleinau/Opitz 1996, S. 132). Anschließend studierte sie Medizin in ihrer Heimatstadt und in München. Nach dem Staatsexamen, das Emmy Grunwald 1912 erfolgreich ablegte, heiratete sie den (später international bekannten) Chemiker Max Bergmann (1886-1944). Aus der Ehe, die Mitte der 1920er Jahre geschieden wurde, gingen zwei Kinder hervor: Peter Gabriel (der ein weltberühmter Physiker wurde) und Esther Marie. Noch im gleichen Jahr ihrer Heirat promovierte Emmy Bergmann mit einer Arbeit "Über Psoriasis und Gelenkerkrankung". Im Jahre 1914 übernahm sie eine unbezahlte Assistentenstelle für Kinderheilkunde am Berliner "Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus". Es folgten Anstellungen in der Säuglingsfürsorge und schließlich als Schulärztin. Anfang September 1922 übersiedelte die Familie Bergmann nach Freiburg/Brsg. Die praktizierende Kinderärztin widmete sich immer mehr pädagogisch-psychologischen Fragen. Sie absolvierte ein Lehrerinnenseminar und legte zu Beginn des Jahres 1925 das Lehrerinnen-Examen ab. Zwischenzeitlich hatte sie noch in Amsterdam einen "Internationalen Montessori-Kurs" besucht und die Lehrbefähigung für die Montessori-Methode erworben. Ihr montessorianisch / pädagogisch-psychologisches Wissen erweiterte sie noch zusätzlich durch Bildungsreisen nach England, Italien und in die Schweiz. Maria Montessori und ihre Schwester Clara Grunwald unterstützten sie in ihrem Ansinnen, in Freiburg/Brsg. Montessori-Einrichtungen zu gründen. Im Frühjahr 1925 eröffnete Emmy Bergmann in ihrer Wohnung das erste Montessori-Kinderhaus in Baden. Zwei Jahre später gründete sie einen Zweigverein der von Clara Grunwald ins Leben gerufenen "Deutschen Montessori-Gesellschaft", der von ihr auch geleitet wurde. Hinzu kam noch eine Montessori-Volksschule mit gelegentlicher Ganztagsbetreuung. In ihrer Privatschule gab es "keine Zeugnisse, keine Versetzungen im üblichen Sinne. Hier wird der Arbeitswille, die Arbeitsfreudigkeit des Kindes anerkannt, jede Arbeit, die dem Bemühen, das Beste zu geben, geleistet wird. Die Arbeit wird nicht abgeurteilt nach ihrem äußeren Erfolge, vor allem nicht nach dem Verhältnis, in dem sie zur Arbeit der anderen steht. Aber das Kind erlangt die wertvolle Erkenntnis, daß jede Arbeit ihren Lohn und ihren Wert in sich selbst trägt, und daß die innere Befriedigung über die Arbeit das höchste Glück ist, daß der Mensch erringen kann" (Bergmann 1925, S. 168).Mit Beginn der Nazi-Diktatur war Emmy Bergmann wegen ihrer "jüdischen Versippung" vielfältigen Diffamierungen ausgesetzt. Die Einwohner Freiburgs wurden aufgerufen, "die nette Erziehungsstätte für die Kinder vornehmster exklusiver Freiburger Gesellschaftskreise, die 'Privatschule Dr. Bergmann' zu boykottieren" (Hatzfeld 2000, S. 78). 1934 wurde sie schließlich vom neuen Bürgermeister Franz Kerber gänzlich verboten. Daraufhin verließ Emmy Bergmann die Stadt und zog zu ihrer Schwester Clara Grunwald nach Berlin. Wenige Monate später "emigrierte sie nach Palästina, wo sie in Jerusalem als Lehrerin und Erzieherin, ganz im Sinne der Montessori-Pädagogik, tätig war" (ebd., S. 80). Nach ihrer Pensionierung lebte sie in einem Kibbutz und kümmerte sich um die medizinische Versorgung der Kinder, die sie auch unterrichtete und wenn nötig, heilpädagogisch / therapeutisch betreute (vgl. ebd., S. 81). Emmy Bergmann starb am 24. April 1972 in Hasorea / Israel.
Einsatz für "schulunreife" Kinder und Montessori-Pädagogik
Die Ärztin und Montessori-Pädagogin betreute in Freiburg/Brsg. mehrere "schulunreife" bzw. von der Schule zurückgestellte Kinder mit dem Ziel, diese "auf den Stand der Normalschule zu bringen" (zit. n. ebd., S. 34). Damit erfüllte ihre Einrichtung die Funktion eines Schulkindergartens, der Kinder aufnahm, "die wegen ihrer 'körperlichen Beschaffenheit', 'geistigen Veranlagung' oder 'Entwicklungshemmung' als 'schulunreif' diagnostiziert und darum zu ihr (von staatlichen und städtischen Behörden; M. B.) geschickt" (zit. n. ebd.) wurden. Für diese Kinder erachtete sie das Montessori-Material als besonders wirkungsvoll, bedingt durch
- die Fehlerkontrolle, ohne dass die Montessori-Lehrerin eingreifen muss;
- die Isolierung der einzelnen Eigenschaften wie: Breite, Länge, Farbe, Gewicht, Form,
- die Variationsbreite des Materials, das verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten zu verschiedenen Altersstufen zulässt;
- die Heilfaktoren des Materials (zit. n. ebd., S. 53).
Emmy Bergmann hatte sich in ihren Publikationen mehr mit der Montessori-Pädagogik in Schulen auseinandergesetzt. Demgegenüber äußerte sie sich in unzähligen Vorträgen und Referaten u. a. in Freiburg, Lörrach, Ulm, Karlsruhe, Stuttgart, Heidelberg etc. über die Bedeutung der Montessori-Pädagogik in vorschulischen Einrichtungen. In einem Vortrag zur "Achtung der seelischen Freiheit" (1930) im ehemaligen "Evangelischen Fröbelseminar" in Ulm-Söflingen, zitierte sie Maria Montessori mit folgenden Worten:
"Wie die geistige Erziehung auf der Basis der Sinne ruht, so muß die moralische Erziehung, will sie die Kinder nicht auf den Weg der Täuschungen, der falschen Begriffe oder der Finsternis führen, sich auf die Grundlage des Gefühls stützen und auf ihr aufbauen: die Erziehung der Sinne und die Freiheit des Geistes, sich nach eigenen Gesetzen zu entwickeln, auf der einen Seite, die Erziehung des Gefühls und die Freiheit der Seele, sich zu erheben, auf der anderen Seite; das sind zwei ähnliche Begriffe und zwei gleichlaufende Wege.
Welches ist unsere Stellung den Kindern gegenüber? Wir sind ihre 'Anreize', durch die sie das Gefühl üben müssen, das ihrer zarten Seele entkeimt.
Für den Verstand finden sie viele Gegenstände bereit: die Farben, die Formen usw.; aber für die Seele sind wir selbst da. Von uns müssen sich die reinen Seelen der Kinder nähren; sie müssen ihre Herzen auf uns richten, wie sie ihre Aufmerksamkeit auf einen selbstgewählten Sinnenreiz richten, und durch die Liebe zu uns muß sich ihr innerstes Seelenleben zum Licht entwickeln" (zit. n. ebd., S. 131 f).
Literatur
- Bergmann, E.: Über die Erziehung und Unterricht in der Montessori-Schule, in: Die neue Erziehung, 1925/H. 3, s. 155-168
- Hatzfeld, D. v.: Clara Grunwald und Emmy Bergmann. Zwei Schwestern im Einsatz (1919-1933) für die Montessori-Pädagogik. ein Beitrag zur Geschichte der Montessori-Pädagogik in Deutschland, Augsburg 2000 (unveröffentl. Diplomarbeit)
- Kleinau, E./Opitz, C. (Hrsg.): Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung. Band 2: Vom Vormärz bis zur Gegenwart, Frankfurt/New York 1996
- Zuletzt bearbeitet am: Mittwoch, 12. Februar 2014 09:13 by Karsten Herrmann