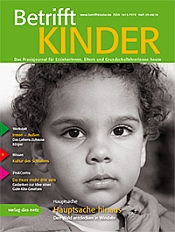Zur Begrüßung wies nifbe-Direktorin Prof. Dr. Renate Zimmer auf die Bedeutung von Bewegung in Bildungsprozessen und auf entsprechende alltagsintegrierte Zugänge zur Sprache hin, „die für Kinder bedeutsam und lustvoll sind“.
Zur Begrüßung wies nifbe-Direktorin Prof. Dr. Renate Zimmer auf die Bedeutung von Bewegung in Bildungsprozessen und auf entsprechende alltagsintegrierte Zugänge zur Sprache hin, „die für Kinder bedeutsam und lustvoll sind“. Sie stellte die gemeinsam mit ihrem Team im nifbe entwickelten Konzepte zur bewegten Sprachförderung und zur Sprachbeobachtung (BaSiK) vor und wies auf deren zunehmende Verbreitung in den Bundesländern und insbesondere in Nordrhein-Westfalen hin.
 Universitäts-Vizepräsidentin Prof. Dr. Susanne Menzel beschrieb „Sprache als Schlüssel zum Bildungserfolg“ und skizzierte verschiedene Ansätze, um über Sprachförderung Bildungsbenachteiligung zu kompensieren. Wichtig sei dabei aber letztendlich, an den Fähigkeiten und Motivationen sowie an den Ressourcen und der Freude der Kinder anzusetzen.
Universitäts-Vizepräsidentin Prof. Dr. Susanne Menzel beschrieb „Sprache als Schlüssel zum Bildungserfolg“ und skizzierte verschiedene Ansätze, um über Sprachförderung Bildungsbenachteiligung zu kompensieren. Wichtig sei dabei aber letztendlich, an den Fähigkeiten und Motivationen sowie an den Ressourcen und der Freude der Kinder anzusetzen.Menzel bescheinigte dem nifbe „sehr erfolgreich neue Forschungsergebnisse in die Praxis zu transferieren“ und unterstrich die Bedeutung der Kooperation zwischen Universität und nifbe. Denn der Transfer spiele auch in den Hochschulen eine immer größere Rolle und gemeinsam könne man hier auch im Hinblick auf das neue Forschungszentrum für frühkindliche Bildung an der Universität Osnabrück neue Wege gehen.
Im Auftaktvortrag zeigte Prof. Dr. Renate Zimmer auch mit vielen bewegten und bewegenden Bildern auf, wie Kinder die Sprache entdecken und „von Anfang an im Dialog sind“ – von Gestik, Mimik, Lächeln und Blickkontakten über Zeigegesten und Handlungsdialoge bis zum dialogischen Bilderbuchlesen. Sie unterstrich die Bedeutung des Vorlesens und wies auf bedenkliche Studien der Stiftung Lesen hin, nach denen heute fast die Hälfte der Eltern nicht mehr vorliest. Aber insbesondere auch im (Rollen-) Spiel kämen Kinder zur Sprache, übten die prosodischen, linguistischen und pragmatischen Kompetenzen ein.
Zimmer stellte auch kurz die Evaluationen der Sprachförderprojekte des nifbe vor und zeigte im Ergebnis auf verschiedenen Ebenen „signifikante Verbesserungen“ im Vergleich mit Kontrollgruppen auf. Insbesondere bei Kindern aus dem unteren Leistungsbereich hätte der unmittelbare Zugang zur Sprache über Bewegung deutliche Effekte gezeigt.
"Sprache entsteht, wenn es etwas mitzuteilen gibt"
„Sprache entsteht, wenn es etwas mitzuteilen gibt“ und „Dialoge entwickeln sich im gemeinsamen Tun“ fasste Zimmer die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Sie mahnte, insbesondere auch schon in der Krippe das Sprachpotenzial der Kinder besser zu nutzen und zu fördern. Gerade hier biete die Bewegung „einen guten und effektvollen Zugang“. In der Folge zeigte nifbe-Mitarbeiterin Dr. Nadine Madeira-Firmino Wege zur alltagsintegrierten Sprachförderung und zur Stärkung der Sprachbildungskompetenz von pädagogischen Fachkräften auf. Zur Zeit würden in den Bundesländern noch ganz unterschiedliche Sprachbildungs- bzw. –förderkonzepte favorisiert. In wissenschaftlichen Studien hätte sich allerdings klar gezeigt, dass eine additive Sprachförderung „ohne die gewünschten Effekte bleibt“. Neben dem Zeitfaktor seinen hier das „Funktionstraining“ und die häufige Konzentration auf einzelne sprachliche Komponenten problematisch. „Sprachbildung zieht sich dagegen durch den gesamten Alltag und nutzt das gesamte Spektrum der Sprach- und Kommunikationsmöglichkeiten“ kontrastierte Madeira-Firmino. In diesem Sinne gelte es die professionelle Kompetenz aller pädagogischen Fachkräfte zu stärken.
In der Folge zeigte nifbe-Mitarbeiterin Dr. Nadine Madeira-Firmino Wege zur alltagsintegrierten Sprachförderung und zur Stärkung der Sprachbildungskompetenz von pädagogischen Fachkräften auf. Zur Zeit würden in den Bundesländern noch ganz unterschiedliche Sprachbildungs- bzw. –förderkonzepte favorisiert. In wissenschaftlichen Studien hätte sich allerdings klar gezeigt, dass eine additive Sprachförderung „ohne die gewünschten Effekte bleibt“. Neben dem Zeitfaktor seinen hier das „Funktionstraining“ und die häufige Konzentration auf einzelne sprachliche Komponenten problematisch. „Sprachbildung zieht sich dagegen durch den gesamten Alltag und nutzt das gesamte Spektrum der Sprach- und Kommunikationsmöglichkeiten“ kontrastierte Madeira-Firmino. In diesem Sinne gelte es die professionelle Kompetenz aller pädagogischen Fachkräfte zu stärken.Wichtig sei es in der alltagsintegrierten Sprachförderung, die individuellen Lebenslagen der Familien zu berücksichtigen, an den Lebenserfahrungen der Kinder anzusetzen sowie in der KiTa authentische und kindzentrierte Alltagssituationen aufzugreifen. Hierfür würden auch keine vorgegebenen Materialien benötigt. Statt punktueller Tests erfordere die alltagsintegrierte Sprachbildung eine prozessbegleitende Beobachtung und einen Paradigmenwechsel von einem defizitorientierten zu einem ressourcenorientierten Blick.
 Die Entwicklung, Umsetzung und Evaluation eines kompetenzorientierten Fortbildungskonzeptes stellte die zu Anfang des Jahres vom nifbe in das Familienministerium in Nordrhein-Westfalen gewechselte Sophie Reppenhorst am Beispiel des vom nifbe durchgeführten BiSS-Projektes in Herford vor. In neun Fortbildungsmodulen wurden gesamten KiTa-Teams ein bewegungs- und handlungsorientierter Sprachbildungsansatz vermittelt. Im Anschluss an die Fortbildung folgte eine Prozessbegleitung, in der insbesondere die Selbstreflexion des Sprach- und Interaktionsverhaltens der Pädagogischen Fachkräfte im Fokus stand. Eine umfassende quantitative und qualitative Evaluation inklusive einer Videointeraktionsanalyse ergab dabei folgende zentrale Ergebnisse:
Die Entwicklung, Umsetzung und Evaluation eines kompetenzorientierten Fortbildungskonzeptes stellte die zu Anfang des Jahres vom nifbe in das Familienministerium in Nordrhein-Westfalen gewechselte Sophie Reppenhorst am Beispiel des vom nifbe durchgeführten BiSS-Projektes in Herford vor. In neun Fortbildungsmodulen wurden gesamten KiTa-Teams ein bewegungs- und handlungsorientierter Sprachbildungsansatz vermittelt. Im Anschluss an die Fortbildung folgte eine Prozessbegleitung, in der insbesondere die Selbstreflexion des Sprach- und Interaktionsverhaltens der Pädagogischen Fachkräfte im Fokus stand. Eine umfassende quantitative und qualitative Evaluation inklusive einer Videointeraktionsanalyse ergab dabei folgende zentrale Ergebnisse:Die TeilnehmerInnen konstatierten
- grundsätzlich eine Weiterentwicklung der eigenen Sprachförderpraxis, insbesondere durch ein gezieltes, entwicklungsangemessenes, kindzentriertes Handeln
- Flexiblere Handlungsmöglichkeiten
- Mehr Handlungssicherheit, Selbstbewusstsein und Arbeitsmotivation
- Größeres Kompetenzerleben
- Mehr Reflexion und größeres Bewusstsein für Sprachbildungsrolle und Sprachbildungsprozesse
Exemplarisch brachte eine pädagogische Fachkraft aus dem Modellprojekt ihre Erkenntnisse und Erfahrungen folgendermaßen auf den Punkt: „Sprachbildung ist nicht, wenn ich mich eine Stunde mit denen hinsetze, sondern Sprachbildung ist –das ist das, was wir jetzt bei euch wirklich noch mal so verinnerlicht gekriegt haben – das ist jede Sekunde, die ich mit dem Kind rede, ist Sprachbildung. Das ist so wichtig.“
Im Anschluss an die Fachvorträge konnten die TeilnehmerInnen in zwei Panels mit je zehn verschiedenen Workshops das ganze Spektrum der alltagsintegrierten Sprachbildung kennen lernen und miteinander diskutieren – von der Verbindung von Sprache mit Bewegung, Tanzen oder auch Naturwissenschaft über Sprachauffälligkeiten und Mehrsprachigkeit bis zu sprachförderlichen Verhaltensweisen und der prozessbegleitenden Sprachbeobachtung.
Karsten Herrmann (Text)
Rosanna Terberger (Fotos)