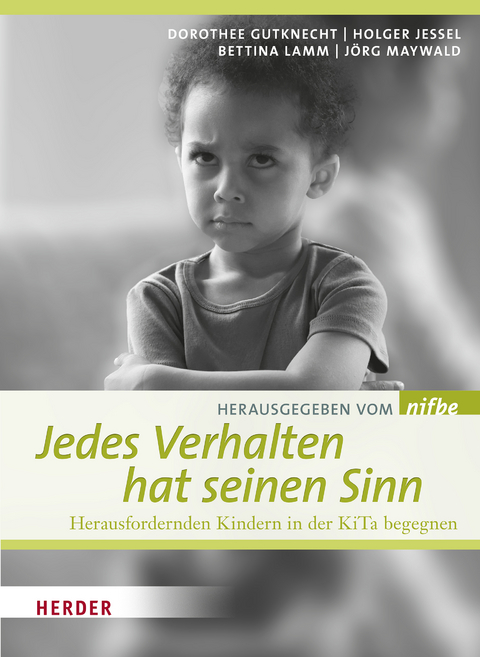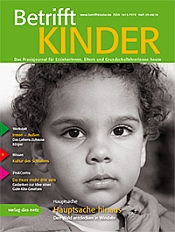- Details
 Jan ter Horst, Abteilungsleiter im niedersächsischen Kultusministerium, freute sich über die große Nachfrage zu dieser frühzeitig ausgebuchten Tagung und begrüßte insbesondere auch zahlreiche VertreterInnen aus der Landespolitik. Er hob die frühkindliche Bildung als Schwerpunktthema der Landesregierung heraus: „Wir müssen schon die kleinsten Lerner aktiv begleiten und ihnen Chancengerechtigkeit bieten“, sagte er. Dabei sei die Elternarbeit von zentraler Bedeutung und hier gäben die Familienzentren mit ihrer breit angesetzten Einbindung von Familien und der sozialräumlichen Vernetzung „zukunftsweisende Impulse“.
Jan ter Horst, Abteilungsleiter im niedersächsischen Kultusministerium, freute sich über die große Nachfrage zu dieser frühzeitig ausgebuchten Tagung und begrüßte insbesondere auch zahlreiche VertreterInnen aus der Landespolitik. Er hob die frühkindliche Bildung als Schwerpunktthema der Landesregierung heraus: „Wir müssen schon die kleinsten Lerner aktiv begleiten und ihnen Chancengerechtigkeit bieten“, sagte er. Dabei sei die Elternarbeit von zentraler Bedeutung und hier gäben die Familienzentren mit ihrer breit angesetzten Einbindung von Familien und der sozialräumlichen Vernetzung „zukunftsweisende Impulse“. „Ohne Eltern geht es nicht in der frühkindlichen Bildung“ unterstrich auch nifbe-Direktorin Prof. Dr. Renate Zimmer in ihrer Begrüßung . Familienzentren seien für sie „ideale Orte der Begegnung und des gemeinsamen Lebens und Lernens“. Sie wies auf zahlreiche Aktivitäten des nifbe zu diesem Themenbereich hin – neben der mittlerweile zweiten Tagung habe das nifbe so eine landesweite interdisziplinäre Expertenrunde zu diesem Thema etabliert, in der Gelingensbedingungen entwickelt, Handreichungen für die Praxis, Fachberatung und Politk definiert und Fortbildungsbedarfe eruiert werden. Im Regionalnetzwerk NordOst formiere sich darüber hinaus ein regionales Netzwerk zu diesem Thema. „Vieles ist hier in Bewegung und wir wollen ErzieherInnen, KiTa-Leitungen, FachberaterInnen und Träger auf ihrem Weg zum Familienzentrum unterstützen“, resümierte die nifbe-Direktorin.
„Ohne Eltern geht es nicht in der frühkindlichen Bildung“ unterstrich auch nifbe-Direktorin Prof. Dr. Renate Zimmer in ihrer Begrüßung . Familienzentren seien für sie „ideale Orte der Begegnung und des gemeinsamen Lebens und Lernens“. Sie wies auf zahlreiche Aktivitäten des nifbe zu diesem Themenbereich hin – neben der mittlerweile zweiten Tagung habe das nifbe so eine landesweite interdisziplinäre Expertenrunde zu diesem Thema etabliert, in der Gelingensbedingungen entwickelt, Handreichungen für die Praxis, Fachberatung und Politk definiert und Fortbildungsbedarfe eruiert werden. Im Regionalnetzwerk NordOst formiere sich darüber hinaus ein regionales Netzwerk zu diesem Thema. „Vieles ist hier in Bewegung und wir wollen ErzieherInnen, KiTa-Leitungen, FachberaterInnen und Träger auf ihrem Weg zum Familienzentrum unterstützen“, resümierte die nifbe-Direktorin.Penn Green Centre als begeisterndes Beispiel
 Einen mitreißenden Einblick in die Potentiale eines Familienzentrums bot Dr. Margy Whalley, die 1983 das nach dem Early Excellence arbeitende Pen Green Centre in Corby aufbaute und bis heute leitet. Exemplarisch vereint dieses Familienzentrum den klassischen Krippen- und KiTa-Bereich mit integrierter umfassender Zusammenarbeit mit Familien, Schule sowie Erwachsenen- und Familienbildung und -beratung rund um das Thema Familie, Frühförderung und Gesundheit. Zum rund 70köpfigen Team gehören so neben ErzieherInnen auch Hebammen, SozialarbeiterInnen, Tagesmütter und Frühförderkräfte. „Auf einem stabilen pädagogischen Fundament lernen die Professionen bei uns voneinander und miteinander und werden durch Coaching und Supervision unterstützt“ berichtete Dr. Magy Whalley. Angeschlossen an Pen Green sei auch ein Hand in Hand mit den PraktikerInnen arbeitendes Forschungszentrum sowie ein Weiterbildungs- und Ausbildungszentrum für Eltern.
Einen mitreißenden Einblick in die Potentiale eines Familienzentrums bot Dr. Margy Whalley, die 1983 das nach dem Early Excellence arbeitende Pen Green Centre in Corby aufbaute und bis heute leitet. Exemplarisch vereint dieses Familienzentrum den klassischen Krippen- und KiTa-Bereich mit integrierter umfassender Zusammenarbeit mit Familien, Schule sowie Erwachsenen- und Familienbildung und -beratung rund um das Thema Familie, Frühförderung und Gesundheit. Zum rund 70köpfigen Team gehören so neben ErzieherInnen auch Hebammen, SozialarbeiterInnen, Tagesmütter und Frühförderkräfte. „Auf einem stabilen pädagogischen Fundament lernen die Professionen bei uns voneinander und miteinander und werden durch Coaching und Supervision unterstützt“ berichtete Dr. Magy Whalley. Angeschlossen an Pen Green sei auch ein Hand in Hand mit den PraktikerInnen arbeitendes Forschungszentrum sowie ein Weiterbildungs- und Ausbildungszentrum für Eltern.Grundsätzliches Ziel in Pen Green sei es, Kinder – und gerade auch solchen aus sozial benachteiligten Familien - stark zu machen und ihre Resilienz zu fördern. „Wir haben ein positives Bild vom Kind und eine differenzierende Pädagogik, die das Kind darin unterstützt, alles zu sein, was es sein kann“ sagte Margy Whalley. Zentral sei dabei auch die niedrig schwellige Zugänge bietende Arbeit mit den Eltern. Diese müsse grundsätzlich auf gleicher Augenhöhe und mit einer anerkennenden und wertschätzenden Haltung stattfinden, so Margy Whalley: „Wir müssen akzeptieren, dass Eltern immer das Beste für ihr Kind wollen.“ Gemeinsam mit den Eltern konnten in Pen Green so auch differenzierte Beobachtungs- und Dokumentations-Schleifen zwischen KiTa und Elternhaus aufgebaut werden, der sogenannte „Pen-Green-Loop“, von denen beide Seiten profitieren. Mit einer Vielzahl von Beispielen belegte Margy Whalley, wie Eltern in Pen Green aktiviert und beteiligt werden, sich ehrenamtlich engagieren oder sogar eine berufliche Perspektive finden können.
Respekt und Wertschätzung als Grundlage der Elternarbeit
 Die Arbeit mit den Eltern spielte auch eine zentrale Rolle in einer folgenden Workshoprunde. So hob Prof. Dr. Angelika Hentschel von der Leuphana-Universität in Lüneburg die Familie als „zentrale Sozialisationsinstanz“ heraus, die aber durch den schnellen gesellschaftlichen Wandel starke Verunsicherung und Belastung erfahre. Hier böten Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit den ErzieherInnen und die sozialräumliche Vernetzung der Familienzentren wertvolle Unterstützung. Grundsätzlich hätten Eltern, so Hentschel, “immer Interesse daran, ihre Kinder zu unterstützen.“ In Übereinstimmung auch mit den Ausführungen Margy Whalleys herrschte in den Diskussionsrunden große Einigkeit darüber, dass die Voraussetzung für erfolgreiche Elternarbeit eine Haltung der Wertschätzung und des Respekts gegenüber den Eltern sei. Dazu gehöre auch ein „wertfreies Zuhören“. Unterstützt werden müssen diese Ausgangs-Haltung u.a. durch professionelles Handwerkszeug der Gesprächsführung und der Konfliktlösung.
Die Arbeit mit den Eltern spielte auch eine zentrale Rolle in einer folgenden Workshoprunde. So hob Prof. Dr. Angelika Hentschel von der Leuphana-Universität in Lüneburg die Familie als „zentrale Sozialisationsinstanz“ heraus, die aber durch den schnellen gesellschaftlichen Wandel starke Verunsicherung und Belastung erfahre. Hier böten Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit den ErzieherInnen und die sozialräumliche Vernetzung der Familienzentren wertvolle Unterstützung. Grundsätzlich hätten Eltern, so Hentschel, “immer Interesse daran, ihre Kinder zu unterstützen.“ In Übereinstimmung auch mit den Ausführungen Margy Whalleys herrschte in den Diskussionsrunden große Einigkeit darüber, dass die Voraussetzung für erfolgreiche Elternarbeit eine Haltung der Wertschätzung und des Respekts gegenüber den Eltern sei. Dazu gehöre auch ein „wertfreies Zuhören“. Unterstützt werden müssen diese Ausgangs-Haltung u.a. durch professionelles Handwerkszeug der Gesprächsführung und der Konfliktlösung.Brandneue Forschungsergebnisse zu den „Wirkfaktoren von Familienzentren“ konnten auf der Tagung auch Prof. Dr. Dörte Detert und Prof. Dr. Norbert Rückert von der Fachhochschule Hannover präsentieren. In einem nifbe-Forschungsprojekt haben sie trägerübergreifend die 21 Familienzentren untersucht, die sich in Hannover mit einer zusätzlichen Förderung von jährlich 40.000 Euro durch die Stadt auf dem Weg zu einem Familienzentrum gemacht haben.
Der Weg lohnt sich
Als Ergebnis der in diesen Familienzentren eingeführten individuellen und ressourcenorientierten Beobachtung nach einem „Hannoveraner Bogen“ verzeichneten viele ErzieherInnen, neue Seiten am Kind entdeckt und Ansatzpunkte für die Förderung bekommen zu haben sowie eine bessere Erreichbarkeit der Eltern. In der Wertschätzung von Angeboten der Familienzentren lag die „Erziehungsberatung“ bei den befragten ErzieherInnen an erster Stelle, gefolgt vom „Elterncafé“ und „Musischen Angeboten“. In der Rangliste der Wertschätzung der Kooperationen lagen die Schulen an erster Stelle, gefolgt von Sprach- und Ergotherapie sowie dem Kommunalen Sozialdienst. Fortbildungsbedarfe der ErzieherInnen wurden mit der Studie insbesondere in den Bereichen Elternarbeit, Organisationsentwicklung und Beobachtung festgestellt.
Grundsätzlich konnten die ForscherInnen bei den Hannoveraner Familienzentren einen „hohen Vernetzungsgrad“ feststellen und zugleich „keine besonders hohe Zusatzbelastung“ der ErzieherInnen. So sei die Zufriedenheit mit dem Umwandlungsprozesse auch „relativ groß“. Als wichtige Gelingengensbedingungen hoben Detert und Rückert die frühe Einbindung aller Beteiligten heraus. Wichtig sei, auf dem Weg zum Familienzentrum nicht zu viel auf einmal zu wollen, sondern sich auf wenige Kernbereiche wie zum Beispiel die Elternarbeit zu konzentrieren.

Homepage Pen Green Centre
Dokumentation der Tagung Familienzentren 2010
- Details
nifbe-Forschungsstelle mit zwei neuen Büchern zum Thema
Nach dem in der nifbe-Schriftenreihe erschienenen Buch „Das einzelne Kind im Blick. Individuelle Förderung in der KiTa“ legt die nifbe-Forschungsstelle Begabungsförderung nun auch Publikationen zur Individuellen Förderung in der Grundschule vor.
Weiterlesen ...- Details
Anlass zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen gaben die jetzt vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Zahlen zur Kindertagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren. Mit einer Betreuungsquote von 19,2 Prozent gehört Niedersachsen zu den Schlusslichtern in Deutschland. Nur Nordrhein-Westfalen schneidet mit einer Betreuungsquote von 15,9 Prozent schlechter ab.
Weiterlesen ...
- Details
Ringvorlesung zur Elementarpädagogik gestartet
 In Kooperation von Universität Osnabrück und nifbe ist jetzt die prominent besetzte Ringvorlesung „Pädagogisches Handeln im Feld der frühen Kindheit“ mit einem Vortrag von Prof. Dr. Lothar Krappmann gestartet. Sie bietet im jetzigen Winter- und kommenden Sommersemester eine systematische Einführung in die Elementarpädagogik – von den entwicklungspsychologischen Grundlagen über aktuelle pädagogische Handlungsansätze bis hin zur Geschichte des Kindergartens. Sie vermittelt dabei, wie Prof. Dr. Hilmar Hoffmann von der nifbe-Forschungsstelle Elementarpädagogik ausführte, „insbesondere Wissen über die Kinder und ihre Familien“.
In Kooperation von Universität Osnabrück und nifbe ist jetzt die prominent besetzte Ringvorlesung „Pädagogisches Handeln im Feld der frühen Kindheit“ mit einem Vortrag von Prof. Dr. Lothar Krappmann gestartet. Sie bietet im jetzigen Winter- und kommenden Sommersemester eine systematische Einführung in die Elementarpädagogik – von den entwicklungspsychologischen Grundlagen über aktuelle pädagogische Handlungsansätze bis hin zur Geschichte des Kindergartens. Sie vermittelt dabei, wie Prof. Dr. Hilmar Hoffmann von der nifbe-Forschungsstelle Elementarpädagogik ausführte, „insbesondere Wissen über die Kinder und ihre Familien“.
- Details
Die Direktorin des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe), Prof. Dr. Renate Zimmer, wertet die von der Koalitionsregierung jetzt beschlossene Einführung des Betreuungsgeldes für Kleinkinder ab 2013 als „bildungspolitisch falsches Signal“. Priorität müsse es haben, die Qualität der institutionellen Betreuung in Krippe und Kindertagesstätte konsequent zu verbessern und die Kinder so in den ersten Jahren „auf bestmögliche Weise zu begleiten und zu fördern.“
Weiterlesen ...- Details
Die Ausbildung der AusbildnerInnen stand im Fokus einer in Kooperation von Leuphana-Universität und nifbe durchgeführten Tagung in Lüneburg. „Denn die bisher allzu sehr vernachlässigte Professionalisierung der Ausbildungsbereiche“, so die Tagungs-Organisatorinnen Prof. Dr. Maria Eleonora Karsten und Maria Thünemann-Albers, „ist eine entscheidende Voraussetzung für die qualitative Weiterentwicklung der gesamten frühkindlichen Bildung und Entwicklung.“ In diesem Sinne wies auch nifbe-Geschäftsführer Reinhard Sliwka in seinem Grußwort der Ausbildung der AusbildnerInnen eine „Schlüssel- und Scharnierfunktion“ bei der weiteren Professionalisierung des frühkindlichen Feldes zu.
Weiterlesen ...- Details
Einen Besuch stattete jetzt der niedersächsische Landtagsvizepräsident Hans-Werner Schwarz (FDP) dem nifbe in Osnabrück ab. nifbe-Direktorin Prof. Dr. Renate Zimmer sowie nifbe-Vorstandsmitglied Prof. Dr. Heidi Keller und nifbe-Geschäftsführer Reinhard Sliwka informierten Schwarz über aktuelle Arbeitsschwerpunkte des nifbe wie zum Beispiel die Sprachförderung und diskutierten gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft.
Weiterlesen ...- Details
Die Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit soll besser werden! Dieser Vorsatz bewegt Fachöffentlichkeit, Elternschaft und Politik. Die Frage ist jedoch: Was genau heißt besser? Welches Ziel wird mit all den Initiativen verfolgt, die in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland ins Leben gerufen wurden?
Um diese Frage aus der Sicht der Praxis zu beleuchten, hat Prof. Dr. Julia Schneewind (Hochschule Osnabrück) im Rahmen des nifbe-Professionalisierungs-Projektes „Die Besten für die Kleinsten“ für das Bundesfamilienministerium den Bericht „Kita 2020 – aus Sicht der Praxis“ erstellt. Seit September 2010 wurden dafür verschiedene Workshops, Diskussionsrunden und Befragungen mit insgesamt 60 Erzieherinnen und Kitaleitungen sowie Fachberaterinnen durchgeführt.
- Details
Wie lässt sich herausfinden, was Kindern wirklich Freude macht und wo ihre Begabungen liegen? Was ist ihr Begabungspotenzial und wie können wir es aktivieren? Wo können Begabungen ihren Ausdruck finden? Welche Rolle spielen dabei Umwelt, Erfahrungen und Kultur? Im Rahmen des Spannungsfeldes dieser und weiterer Fragen diskutiert und forscht die interdisziplinäre Forschungsstelle Begabungsförderung des nifbe.
Weiterlesen ...- Details
Viele Einrichtungen machen sich in Niedersachsen derzeit auf den Weg zu einem Familienzentrum – doch was bedeutet das inhaltlich und strukturell? Was sind die zentralen Interessenlagen und Fragen, wo gibt es am meisten Beratungs- und Unterstützungsbedarf? Diese und andere Fragen möchte eine Online-Umfrage des nifbe zum Entwicklungsstand von Familienzentren beantworten. Sie richtet sich an Kindertageseinrichtungen, Familienbildungsstätten, Mehrgenerationenhäuser und Beratungseinrichtungen
Weiterlesen ...